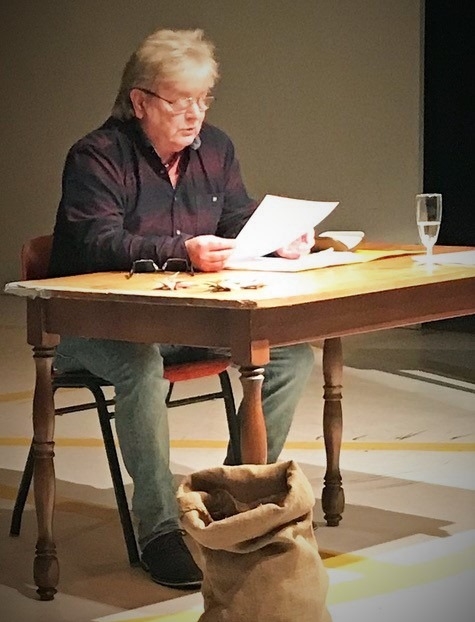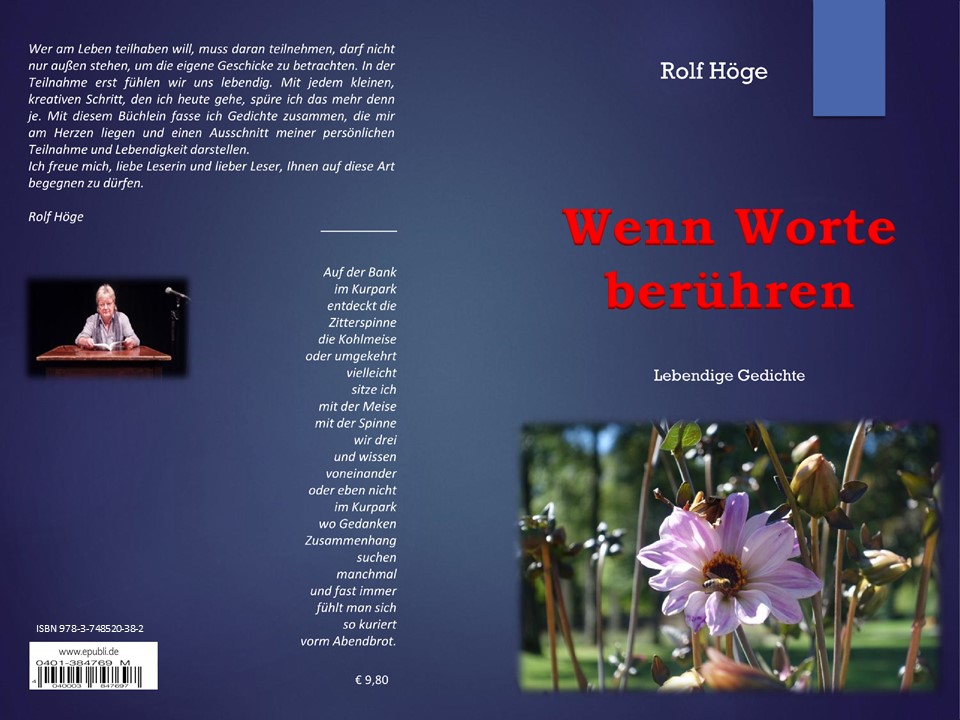Ich bin kein religiöser Mensch. Ich denke, Religion wurde von Menschen erfunden und für Menschen gemacht. Religion benötigt für seine Existenz ein Regelwerk in Form von Ritualen und Verhaltensanweisungen. Religion versucht, den Grund menschlichen Daseins zu erklären, nicht zu untersuchen. Religion fragt nicht nach dem Sinn, Religion liefert den Sinn. Und für viele ist es genau das, was sie in ihrem Leben suchen: eine Antwort auf die Frage, was der Sinn des Lebens sei. Vor diesem Hintergrund erfüllt jede Religion für ihre jeweiligen Anhänger ihren Zweck, wenn sie dem religiösen Bild zusätzlich Lebensmodelle hinzufügt, nach denen die Gläubigen ihrem Glauben entsprechen können, und wenn sie das menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit bedient.
Die Frage nach der Existenz eines Gottes wird aus der jeweiligen Religion heraus regelmäßig bejaht, wobei grundsätzlich die konkrete oder abstrakte Vorstellung der Religionsgemeinschaft über das Gottesbild als Grundlage für die Beantwortung dieser Frage dient. Der Glaube daran wird eingefordert, das Nichtglauben mit Konsequenzen belegt.
Kürzlich fragte ich meinen Sohn, der sich zur Evangelischen Freikirche zählt, ob er denn tatsächlich an Gott glaube. Ja, antwortete er, er sei davon überzeugt. Ob er denn an diesen Gott Abrahams glaube, wie er in der Bibel beschrieben ist, an den himmlischen Vater, wollte ich dann weiter wissen. Ja, bezeugte er. Ich erklärte ihm, dass es mir absolut unverständlich ist,. wie jemand an ein Wesen außerhalb seiner selbst glauben kann, das einen derartig stark ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex hat. Denn wie anders könne man es nennen, wenn der himmlische Vater von seinem geliebten Moses verlangt, dass dieser den Sohn zur Schlachtbank führe, um Gott, dem gütigen Vater, seine Liebe zu beweisen. Das ist Nötigung, das ist Machtmissbrauch. An diesen biblischen Gott kann ich leider nicht glauben, auch wenn dieser Tausende von Jahren nach diesem Ereignis entschied, von nun an für die Christen ein gütiger, liebender Gott zu sein. Zumal der zur Erlösung gesandte Sohn erst im 4. Jahrhundert nach seiner Geburt von Rom zum Sohn Gottes und diesem wesensgleich gekürt wurde.
Von der philosophischen Essenz hier sehe ich mich eher dem traditionellen, ursprünglichen Buddhismus zugeneigt. Das hat zwei Gründe. Zum einen sucht der Buddhismus nicht nach dem Sinn des Lebens und liefert dazu auch keine Erklärung ab. Nach der Überlieferung suchte Buddha die Gründe für die Entstehung allen Leids und die Lösung für die Auflösung allen Leids. Zusammengefasst kann man sagen, dass alles Leid durch den Menschen entsteht und durch diesen auch aufgelöst werden kann. Da gibt es nichts außerhalb des Menschen selbst, das steuert oder regelt. Zum anderen machte Buddha, sofern man der Überlieferung glauben kann, aus seinen Erkenntnissen keine Glaubensfrage. Er forderte seine Anhänger nicht auf, ihm zu glauben, sondern riet ihnen, seine Erkenntnis durch eigenes Erleben, durch eigene Erfahrung zu überprüfen. Ein weiterer Grund für die Unterscheidung zwischen klassischem Buddhismus und Religion, ist die Frage des Gebets. Ein Buddhist betet nicht zu irgend etwas oder zu irgend jemandem außerhalb von ihm. Ein Buddhist geht in die Kontemplation, er meditiert über eine Fragestellung, ein Thema.
Doch wie ich oben schon geschrieben habe: der Mensch hat ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit. Er möchte die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet haben, er sucht nach Sinn für sein Dasein. Und so wurde aus dem ursprünglichen Buddhismus schnell eine Religion mit allen Facetten: mit Geistern der Verstorbenen, mit Gebetsmühlen, mit Wiedergeburten, mit so ziemlich allem, was zu einer waschechten Religion dazu gehört, inklusive Hierarchieebenen der Religionsführer und Unterdrückung des einfachen Volkes, worüber man in unserer westlichen Welt nicht viel wissen will, wenn es beispielsweise um die mittelalterlichen, menschenverachtenden Unterdrückungsmethoden durch tibetische Lamas geht.
Doch trotz allem bin ich ein spiritueller Mensch. Nein, kein Esoteriker. Esoterik und Spiritualität kommt für mich nur in den seltensten Fällen zusammen. Esoterik ist ein riesengroßer, legitimer Wirtschaftsmarkt mit einem Milliarden-Umsatz jährlich allein in Deutschland, mit der großen Zielgruppe der Sinnsuchenden, der Fragenden. Auch wenn Buchverlage dazu übergehen, ihre Produkte immer weniger als Esoterik zu klassifizieren, sondern in der Rubrik Lebenshilfe oder Spiritualität einzuordnen, hat das mit der Spiritualität wie ich sie für mich definiere nicht viel zu tun. Und wenn die liebe Gerda aus D-Stadt sich über eine Telefon-Hotline ihre Zukunftsfragen beantworten lässt, hat Gerda wohl eher ein Problem mit sich selbst als mit ihren Lebensumständen. Nur weiß sie das in der Regel nicht und insofern ist auch das okay.
Für mich liegt der erste Schritt des Erfahrens der eigenen Spiritualität darin, zu erkennen, dass es eine Wahrheit gibt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich tue hier nun dasselbe, was Religionen tun, wenn sie die Schöpfung ‚Gott’ nennen. Ich gebe dem, was ist, einen Namen, etikettiere es und nenne es „Wahrheit“. Und Wahrheit ist alles, was ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte erklären, was ich damit meine und was es für mich bedeutet.
Noch zu Anfang des Mittelalters galt der Donner während eines Gewitters für die Menschen damals als ein Ausdruck des Zornes Gottes. Selbst meine Mutter sprach noch in den 1950ern Jahren davon, dass der liebe Gott sich ärgere und es deshalb draußen blitze und krache. Heute weiß man, dass der Donner dadurch entsteht, dass sich aufgeheizte Luft in einem Blitzkanal schnell ausdehnt, die Luft in Schwingung versetzt und dadurch den Knall verursacht. Für uns hörbar, weil die Schwingung der Luft auf einen Resonanzboden in Form unserer Trommelfelle trifft. Das ist eine Wahrheit. Diese Wahrheit ist aber nicht erst seit der Erforschung des Gewitters entstanden. Diese Wahrheit war schon immer da. Diese Wahrheit existiert und wird weiter existieren.
Was für mich nun die ganze Sache spirituell macht, in Form von Wahrhaftigkeit, wird vielleicht durch die folgende, spannendere Feststellung noch deutlicher: Wenn ich meinen Daumen betrachte, so ist dieser Daumen zwar ein Teil von mir, aber ich bin nicht mein Daumen. Nimmt man von meinem Daumen eine DNA – Probe, so findet man darin alle Informationen, die meinen Daumen eben einen Daumen sein lassen. Aber man findet in dieser Probe auch alle Informationen, um mich als Mensch komplett nachbauen zu können und eben nicht nur meinen Daumen. Gehen wir hinunter zu meinem kleinen Zeh, finden wir dort dasselbe Phänomen: alle Informationen, damit mein kleiner Zeh zu einem kleinen Zeh werden konnte, aber auch alle Informationen, um mich komplett nachzubauen. Eine Art Gesetzmäßigkeit, die nicht erst seit der Entdeckung der DNA existiert. Eine Wahrheit, die schon immer war, die ist und sein wird. Eine schöpferische Wahrheit, die nichts fordert, nichts verlangt, die keine Glaubensbekenntnisse aufstellt. Eine schöpferische Wahrheit, die für sich gesehen neutral ist und einfach existiert.
Zu Erkennen, dass es eine grundlegende Wahrheit gibt, die wir durch unsere Forschungen in manchen Bereichen aufgedeckt haben und in anderen Bereichen eben noch nicht, ist für mich der Beginn eines spirituellen Pfades. Jedes auch noch so kleine In-Berührung-Kommen mit dieser Wahrheit, dieser Wahrhaftigkeit, sei es durch Forschung und Entdeckung, durch Kontemplation, durch Meditation ist für mich ein spirituelles Highlight.
Diese Wahrhaftigkeit einem Glaubenssystem einzuordnen oder es mit dem abgelutschten Etikett ‚Gott’ zu versehen, macht sie zu einem Konstrukt, beraubt sie ihrer Neutralität und entzieht ihr aus meiner Sicht jeden schöpferischen Aspekt.
Vielleicht ist der eine oder andere Leser geneigt, mir meine Spiritualität abzuerkennen, weil er das, was ich hier schreibe so ganz und gar nicht spirituell betrachten kann, fehlt doch irgendwie der religiöse, verklärende, mystische Bezug. Nun, das ist für mich auch okay. Denn es mag ja sein, dass ich mich absolut irre und nach meinem Tod vollkommen erstaunt auf diesen christlichen Gott treffe. Dann wird er sich allerdings ein paar Fragen von mir zu der Nötigung von Moses gefallen lassen müssen. Bis dahin…
© Rolf Höge